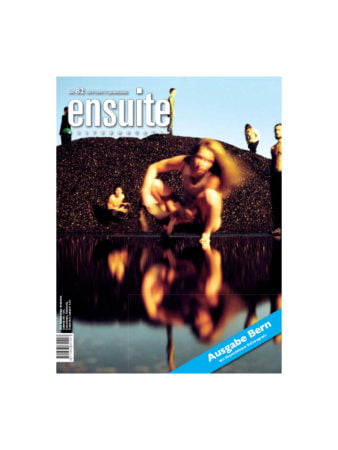Von Karl Schüpbach — Vorerst einmal… In der Presse von heute (10. September 2009) wird von Musik-Theater-Bern geschrieben. Gemeint ist damit der Name der neu zu schaffenden Dachorganisation, welche die bisherigen grossen Institutionen, das Stadttheater (STB) und die Stiftung Berner Symphonieorchester (BSO) in eine einzige Trägerschaft vereinen soll. Das Ganze ist vorläufig so unklar und ohne fassbare Konturen, dass es unmöglich ist, zu diesem Beschluss der Regionalen Kulturkommission Bern Stellung zu beziehen. Nur soviel: Hier wurde der Grundstein für eine Entwicklung gelegt, für moderne Strukturen; oder aber der Wegweiser zeigt in Richtung völliges Fiasko.
Zur Sache Der oben gewählte Titel bezieht sich also nicht auf Strukturfragen, sondern er will den Spielplan der Oper im Berner Stadttheater hinterfragen. Es ist bedauerlich, dass diese brennende Frage nicht diskutiert wird, obwohl sie in den allmählich ermüdenden Diskussionen über Reibereien zwischen dem STB und der BSO viel Raum einnehmen müsste! Anders ausgedrückt: Man wird nicht müde, über die Streitereien der beiden Institutionen zu sprechen und zu schreiben, ohne sich aber auf eine Analyse der Ursachen einzulassen. Auch auf die Themen Finanzen und Disposition will ich hier nicht eingehen.
Dafür aber: Der «Rosenkavalier» in Bern – muss das sein? Aus meiner Sicht muss sich das STB einen schweren Vorwurf gefallen lassen: Dem Haus ist es bis heute nicht gelungen, sich in Sachen Spielplan in der Schweizer Opern-Szene zu positionieren. Der Blick nach Zürich und Genf (die Situation in Basel kenne ich zu wenig) deckt sofort auf, dass die beiden Häuser viel grösser sind und daher auch über wesentlich geräumigere Platzverhältnisse für die jeweiligen Orchester verfügen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, und es kann in unserem Zusammenhang nicht schwerwiegend genug gewichtet werden. Wenn Sie eine Partitur einer Oper aufschlagen, so werden Sie unschwer feststellen, dass das Werk eine bestimmte Anzahl von Bläsern, Schlagzeugern usw. verlangt. Obwohl vielleicht zahlenmässig nicht festgelegt, müssen die Streicherregister so besetzt werden, dass das klangliche Gleichgewicht gewährleistet ist. Die Gleichung ist sehr einfach: Je grösser die Bläser-Schlagzeugbesetzung ist (hier kann nicht gemogelt werden, weil es sich ausnahmslos um solistische Stimmen handelt), desto mehr Streicher müssen eingesetzt werden. Als Beispiel mögen die populären Werke von Strauss und Wagner dienen. Die Bläserbesetzung von «Der Rosenkavalier» von Strauss verlangt, nicht willkürlich, sondern um das klangliche Gleichgewicht zu wahren, mindestens 14 erste Violinen, zusätzlich, proportional dazu, die anderen Streicherregister. Zürich und Genf erfüllen diese Forderung nach adäquatem Platz problemlos. Und Bern? Hier wird der Rosenkavalier mit 10 ersten Geigen gespielt, man nimmt also ein klanglich totales Ungleichgewicht in Kauf. «Das Berner Publikum hat auch ein Anrecht auf Strauss, ein Mitlied des BSO darf auch einmal…». Diese Argumentation ist künstlerisch nicht haltbar und – unbewusst – auch rücksichtslos, wie weiter unten zu lesen sein wird… Mein Vorschlag: Lassen wir doch dieses Möchtegern-Zürich oder ‑Genf bleiben.
Die Opernliteratur bietet unzählige Kleinode, die in Bern problemlos aufgeführt werden können. Ich darf dies aus der Erfahrung heraus sagen. Ich hatte das Privileg, nach 1964 als Orchestervorstand unzählige Gespräche mit dem damaligen Theater-Direktor, Dr.h.c. Walter Oberer, führen zu dürfen. Obwohl auch er auf zu grosse Besetzungen nicht verzichtet hat, war es doch sein Bestreben, Opern aufzuführen, für die der kleine Orchestergraben in Bern sich wie massgeschneidert anbot. Zwei Werke bleiben mir unvergesslich: «Ascanio in Alba» von Mozart und «Moses» von Rossini. Die beiden damals unbekannten Werke wurden weder in Zürich noch in Genf aufgeführt, und sie haben von Bern aus einen wahren Triumphzug durch Europa angetreten, natürlich mit dem entsprechenden Echo in der Presse. Ein weiteres Beispiel, das zeigt, dass Bern durchaus in der Lage wäre, in der Schweizerischen Opern-Szene einen unbesetzten Nischenplatz einzunehmen: Der Bibliothekar des Opernhauses Zürich hat uns sein Material zur Verfügung gestellt. Auf meine Frage, wie wir uns erkenntlich zeigen könnten, bat er ohne Zögern um Karten für eine moderne Oper in kleiner Besetzung, die bei uns gerade gespielt wurde. Er tat dies mit der Bemerkung, dass ein solches Werk in Zürich nicht zur Aufführung gelangen würde, weil es das erfolgverwöhnte Publikum zu wenig anspreche!
Die SUVA (Schweizerische Unfall-Versicherungsanstalt) müsste eingreifen! Die Situation ist sehr ernst: Die Kritik am Spielplan des STB erfolgt keineswegs aus einer Abneigung gegen die spätromantische Oper heraus. Im Gegenteil: Wie herrlich ist es, im Opernhaus Zürich einer Aufführung von «Der Rosenkavalier» zu lauschen. Die in sich stimmige Werkbesetzung entführt uns in die schwelgerische Klangwelt von Strauss.
Zurück nach Bern: Zu grosse Formationen mit den entsprechenden Phonstärken gefährden in dem zu kleinen Orchestergraben die Gesundheit der Musikerinnen und Musiker des BSO! Es ist eine einwandfrei erwiesene Tatsache, dass verschiedene Kolleginnen und Kollegen sich mit schweren Gehörproblemen herumplagen. Ich kann mich gut erinnern, dass die engen Raumverhältnisse zusätzlich zu Platzangst und Aggressionen führten. Die Belastung und die entsprechenden Ermüdungserscheinungen werden noch schlimmer, wenn die Aufführung einer ungeeigneten Oper in eine Woche mit gleichzeitiger Probenarbeit für ein Sinfoniekonzert fällt.
Es ist unverständlich, dass es immer wieder Dirigenten gibt, die das Orchester dahingehend kritisieren, dass es mit zu lautem Spiel die Sänger-Stimmen übertöne. Meine sehr häufigen Besuche in der Oper zeigen bei grossen Besetzungen immer wieder das gleiche Klangbild: Das instrumentale Gleichgewicht ist zu Ungunsten der Streicher empfindlich gestört. Im Übrigen müsste es sich nun definitiv herumsprechen: Es ist ein akustisches Phänomen, das 16 Geigen bei Piano-Stellen leiser klingen als 10!
Was gibt es da noch zu sagen? Vor Jahren dirigierte ein bekannter italienischer Dirigent (nein, nicht Nello Santi) die Oper «Nabucco» von Verdi an unserem Stadttheater. In diesem grossartigen Werk ist das Cello-Register während einer Arie solistisch aufgeteilt, nebst den Tutti-Cellisten. Der Dirigent fand in Bern eine Cello-Gruppe vor, die aus Platzgründen nicht in der Lage war, die verlangte Anzahl Cellistinnen und Cellisten aufzubieten. Offenbar war der Gast-Dirigent über die räumlichen Verhältnisse im Orchestergraben nicht ausreichend orientiert worden. Jedenfalls fauchte er uns an und schlug vor, wir sollten zur Premiere nicht in der gewohnt festlichen Kleidung auftreten, sondern in einem T‑Shirt mit der Aufschrift: Bern Chamber Orchestra plays Nabucco.
ensuite, Oktober 2009